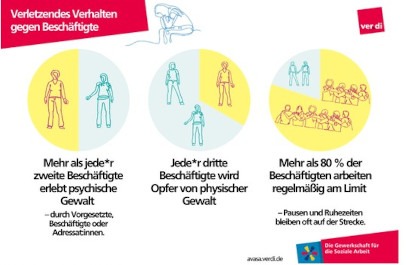Allgemeines
Wohnen gehört zu den elementarsten Bedürfnissen des Menschen. Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung sind daher als Teil der physischen Existenz im Rahmen des menschenwürdigen Existenzminimums auch verfassungsrechtlich garantiert. Unter den vielen Gründen, die zur Wohnungslosigkeit führen können, stellt die Inhaftierung einen wichtigen Grund dar. Nach dem Wohnungslosenbericht der Bundesregierung ist bei 12 Prozent der Personen die Inhaftierung Ursache für die Wohnungslosigkeit.
Dass die prekäre Wohnsituation auch nach der Haftentlassung ein großes Problem darstellt, zeigen auch die Ergebnisse der Lebenslagenstudie der BAG-S. Danach lebt mehr als ein Drittel der Haftentlassenen, die die Angebote der Freien Straffälligenhilfe in Anspruch nehmen, in prekären Wohnverhältnissen. Sie haben keinen eigenen Mietvertrag und sind auf die Wohnungsnotfallhilfe angewiesen.
Aber auch umgekehrt sind Menschen ohne festen Wohnsitz einem erhöhten Risiko ausgesetzt, verhaftet und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt zu werden. Können sie in einem Ermittlungsverfahren keine Adresse angeben, droht ihnen die Untersuchungshaft. Verfügen sie nicht über ausreichende finanzielle Mittel, droht ihnen eine Ersatzfreiheitsstrafe für die nicht bezahlte Geldstrafe. Auf diese Weise entsteht ein Drehtüreffekt zwischen Inhaftierung und Wohnungslosigkeit, der weder aus sozial- noch aus kriminalpolitischer Sicht gewollt sein kann.
Um dem entgegenzuwirken sind im Zusammenhang von Wohnen und Inhaftierung zwei wichtige Ziele zu nennen:
- die Sicherung bestehender Mietverhältnisse bei Inhaftierung und
- die Verhinderung der Entlassung in die Wohnungslosigkeit.